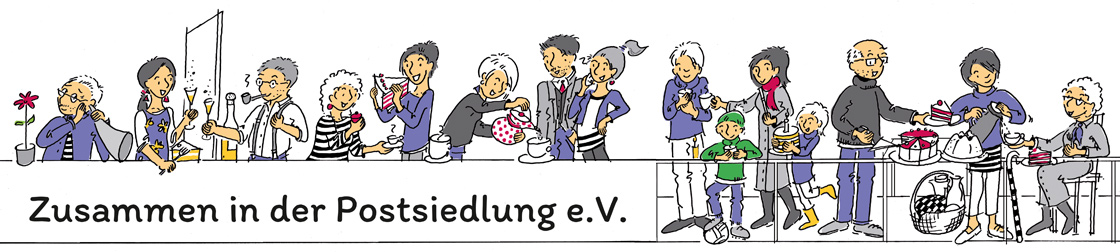Uns hat ein wirklich toller Text von Mara Anders erreicht, die in der Zeit von 1949 – 1959 in der Postsiedlung aufgewachsen ist. Wir dokumentieren diesen hier ungekürzt. Viel Spaß!
Zweieinhalb Zimmer mit Frankfurter Küche. Meine Mutter war 1948 wenig begeistert, dass sie ein Jahr später mit zwei kleinen Kindern von Mannheim nach Darmstadt ziehen sollte. Nur die Frankfurter Küche, die hatte es ihr angetan. Alles auf engem Raum erreichbar – wunderbar.
Der Umzug im Frühsommer 1949 war schnell geschafft. Man hatte ja nicht viel. Mein Vater baute für´s Kinderzimmer zwei Klappbetten und einen Klapptisch vor das Fenster. Eine alte Holzkiste und ein Korb. Das reichte für das Spielzeug von meinem Bruder und mir. Und ließ in dem halben Zimmer etwas Raum zum Spielen. (1)

Die ersten Erinnerungen? Ich war vier Jahre alt, mein Bruder drei und wir stehen Hand in Hand vor der Oppenheimer Str. 15 (heute abgerissen). Zwei Sandsteinstufen runter und links rum ein kleiner Sandkasten, dahinter eine Teppichstange. Das wurde bald unser liebster Spielplatz. Im Sand erst Kuchen, später Landschaften bauen. Vieles von unserem Miniatur-Spielzeug aus dem Erzgebirge ist im Sand verschwunden: Kleine Kühe, Pferde, Schweine, kleine Häuser und Gartenzäune.
Die Teppichstange war beliebtes Turngerät: Um die Stange drehen, sich hoch robben und oben auf der Querstange sitzen, von dort runter hängen lassen, am liebsten kopfüber. (2)

Auf dem Kiesweg, der auf der Rückseite der Gärten von der Wormser Str. entlang lief, wurden Hickelspiele aufgezeichnet, Wohnungen mit ausgefeilten Grundrissen und erste Schreibübungen. Im Gebüsch haben wir uns Höhlen geschaffen, kleine Burgen, uns gegenseitig besucht und bekämpft. Die Siedlung war voll mit Kindern, denn in fast allen Wohnungen lebten Familien. Das war oft ein Ärgernis für ältere Ehepaare, die ihre Ruhe haben wollten. Bei uns im Haus wohnte im 1. Stock so ein Paar. Wenn wir unten spielten wurden wir mit Argusaugen beobachtet. Kaum machte einer von uns einen Schritt auf den Rasen, ging oben das Fenster auf und eine Schimpftirade wurde über uns ergossen. Meist haben wir uns dann kleinlaut zurück gezogen. Meist ins Gebüsch. (3)

Der „Rasen“ war übrigens eher eine Wiese und wurde als Bleiche genutzt. Bei Sonnenschein lag die Bettwäsche ausgebreitet auf dem Gras zum bleichen. Gewaschen wurde sie vorher in der Waschküche in dem großen Bottich, der mit Kohle geheizt wurde. Während des Bleichens hat sich so manches Insekt in die Wäsche verirrt.
In dem Gebüsch wurde auch ein Klub gegründet, der kurz darauf wegen Streitigkeiten wieder zerfiel. Wo die eingezahlten 10 Pfennig pro Person geblieben sind, ist bis heute ungeklärt. Das Gebüsch lieferte uns Nahrung wenn wir Vater-Mutter-Kind spielten. Dort wuchsen ganz viele Buschrosen. Die Kerne nutzten wir als Juckpulver, die Schale wurde gegessen. Auch die kleinen festen Blätter vom Hirtentäschel haben wir gegessen, Sauerampfer gekaut und Kleeblüten ausgezutzelt.
Besonders beliebt war bei den Erwachsenen die Terrasse. Ebenfalls mit Sandsteinplatten belegt. Von uns wurden sie ab und zu als Hickelspiel benutzt. Oder mal mit Kreide bemalt. (4)

Natürlich gab es auch den Spielplatz mit dem Planschbecken in der Binger Straße. Der war überwiegend von Jungs belegt, die dort rumtobten oder Fußball spielten. Für mich deshalb nur im Sommer interessant. Wenn es so richtig heiß war, tauchten wir ins Wasser und legten uns dann auf die Binger Straße um nasse Figuren zu hinterlassen. Die Alternative waren Waschbütten vor dem Haus, in die wir uns dann zu mehreren quetschten. (5)

Bei weniger heißem Wetter wurde auf der Straße Rollschuh gefahren. Immer wenn Marika Kilius und Hansjürgen Bäumler im Fernsehen zu bewundern waren, kamen anschließend alle Kinder mit ihren Rollschuhe auf die Straße und versuchten sich so graziös wie diese zu drehen und den “Flieger” zu machen.
Mit dem größer Werden wuchs unser Radius. Eigentlich durften wir nicht aus der Siedlung gehen, aber die verlassenen Gärten zwischen Moltkestraße und Donnersbergring waren unwiderstehlich. Dort wurde Räuber und Gendarm gespielt: über verrostete Zäune hinweg durch die Johannisbeerbüsche im Bogen an den Brombeeren vorbei und in halb zerfallenen Gartenhütten. Wer einmal gut versteckt war, wurde nicht so schnell gefunden. Im Sommer waren natürlich die Beeren, Äpfel, Birnen und Kirschen großer Anziehungspunkt. Mit der Beute traf man sich dann auf der Bank im Transformatorhäuschen Moltkestraße, Ecke Oppenheimer Straße.
Mitten in den Gärten war übrigens eine Wiese, die einem Bessunger Bauern gehörte. Der mähte das Gras und holte das Heu später mit einem Pferdefuhrwerk ab. Am Rand stand eine große Weide in der wir klettern konnten. Ich meine mich an einen kleinen Bach oder Rinnsal zu erinnern, bin mir aber nicht ganz sicher.
Auf der anderen Seite war das Gelände der heutigen Wilhelm-Leuschner-Schule eine einzige Brachfläche. Spannend dadurch, dass einige Bombenkrater dort waren. Wir buddelten darin nach Granatsplittern. Ob wir welche gefunden haben, weiß ich nicht mehr. Gegenüber der Einmündung der Oppenheimer Straße in die Bessunger Straße war eine Milchbude. Dorthin wurden wir mit der Kanne aus Blech geschickt, um Milch zu holen. Einkaufen war für Kinder nicht unbedingt einfach. Wenn der Laden voll war, passierte es öfter, dass wir als Kinder einfach zur Seite geschoben wurden, weil die Erwachsenen es eilig hatten.
Interessanter war für uns Kinder der Wohnzimmerladen von Börner in der Wormser Straße. Ich glaube so hieß das Geschäft, das in einem ehemaligen Wohnzimmer untergebracht war. Das zweite oder dritte Haus links, wenn man aus dem Durchgang zwischen Oppenheimer und Wormser Straße kam. Da gab es auf engstem Raum viel zu entdecken, denn der Laden führte neben Schreibwaren auch Spielzeug. Ich erinnere mich an einen billigen Teddy, den meine Potsdamer Tante mir dort mal gekauft hatte.
Ja und dann gab es mitten in der Siedlung Mannesmann, Lebensmittelladen und Treffpunkt für Klatschgeschichten. Dorthin wurde ich oft geschickt, wenn meine Mutter mitten im Kochen merkte, dass ihr etwas fehlte. Da ich ziemlich schüchtern war, brauchte ich oft viel zu lange um das Gewünschte nach Hause zu bringen. Also, gerne bin ich nicht gegangen.
Viel attraktiver für uns Kinder war das Pilztörtchen, eine kleine Bäckerei in einem kreisrunden Bau Moltkestraße Ecke Wormser Straße. Meist kauften wir dort Amerikaner, die waren billig und süß. Aber noch interessanter war die Bude in der Moltkestraße kurz vor der Bessunger Straße. Heute weiß ich, dass das ein Buxbaum-Entwurf war. Früher war viel wichtiger, dass es dort Maom und Himbeerbonbons gab. Oft hatte ich eine Gewissensentscheidung zu treffen: Mutter gab mir 20 Pfennig für den Bus zum Ballettunterricht bei Hanna Seyfert am Luisenplatz. Aber ich wollte lieber 40 Himbeerbonbons dafür kaufen. Wie sollte ich ihr erklären, dass ich keinen Busfahrschein mit nach Hause brachte?
In dem Haus hinter dem Kiosk war an jeder Ecke ein Geschäft. An der Bessunger Straße ein Bäcker und an der Moltkestraße nach meiner Erinnerung ein Metzger. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und dann gab es Schade und Füllgrabe an der heutigen Rüdesheimer Straße. Die existierte damals noch nicht. Wir konnten ziemlich ungehindert bis zum Walddreieck laufen. Das lag südlich der Brücke in die Heimstättensiedlung auf der linken Seite der Bahn. Heute stehen dort Wohnblocks.
In dieses Waldstück führte auch unser Osterspaziergang. Unser Vater verblüffte uns lange damit, dass immer da, wo er stand plötzlich ein Ei lag. Ohne dass er sich gebückt hatte. Irgendwann haben wir dann rausgekriegt, dass er ein Loch in der Hosentasche hatte und die Eier sein Bein runterrollen ließ.
Als in den 50er Jahren dann die Gärten verschwanden und die heutige Heinestraße entstand war das zunächst auch Abenteuer für uns. Riesige Sandhaufen auf denen man spielen konnte – natürlich war das nicht erlaubt. Auch die Gerüste an den Neubauten forderten uns heraus. Ebenfalls verboten – aber wir waren daran gewöhnt ohne Aufsicht zu spielen und zu Hause nichts zu verraten. Uns war allerdings klar, dass wir bei dem Sand aufpassen und dass wir uns vor rostigem Stacheldraht hüten mussten.
Wie schon gesagt, die Siedlung war voller Kinder. Es gab Banden, es gab erbitterte Feindschaften, es gab Mutproben, die teilweise ziemlich herausfordernd waren. Z.B. haben einige Jungs den Kanaldeckel in der Binger Straße hoch gestemmt und andere aufgefordert, sich dort für kurze Zeit einschließen zu lassen. Das galt als die ultimative Mutprobe.
Vor Schuleintritt gingen einige Kinder in den Kindergarten. Es gab nur zwei zur Auswahl. Der katholische in der Bessunger Straße Ecke Donnersbergring (heute das Restaurant Flambée) und der evangelische gegenüber der Herderschule in einem damals herunter gekommenen Fachwerkhaus. Da der Weg kürzer war, kam ich in den katholischen Kindergarten. Schwester Radigunda führte dort ein strenges Regiment. Auf Stühlchen sitzend mussten wir vor dem Frühstück die Hände hinter dem Rücken falten. Dann wurde gebetet und dann gegessen. Toilettengang auf Kommando. Gespielt wurde an den Tischen. Besonders erinnere ich mich an die QuäkerSpeisung (später auch noch in der Schule). D.h. eine Quäkergemeinde in Amerika hat die Patenschaft für den Kindergarten übernommen und ließ uns Milch zukommen. Was es sonst noch zu essen gab, weiß ich nicht mehr. Aber an eines erinnere ich mich genau: zweimal in dieser Zeit kamen zugeschnittene Stoffe aus denen meine Mutter mir ein Kleid nähen konnte. Auf diese Kleider war ich sehr, sehr stolz. (6)

Später gab es dann sehr lange Schulwege. Die nächste Schule war damals die Mornewegschule. Für eine 6jährige immerhin eine halbe Stunde Weg. Später die Viktoriaschule, dass war eine dreiviertel Stunde hin und eine dreiviertel Stunde zurück. Natürlich immer zu Fuß. Oft ging es die Bessunger Straße hoch. Zwischen Donnersbergring und Heidelberger Straße hatten alle Häuser auf der rechten Seite einen Vorgarten. Als die Straße verbreitert wurde roch es immer sehr intensiv nach Teer. Aber kaum hatte man die Ampel überquert kam ein intensiver Fischgeruch. Denn zwischen Heidelberger Straße und Petruskirche war auf der linken Seite etwas zurück gesetzt eine Bude, die Fisch verkaufte. Besonders frisch kann der nicht gewesen sein.
An ein Geschäft habe ich noch Erinnerungen, nämlich an den Friseur, der heute noch Bessunger Straße Ecke Donnersbergring existiert. Dorthin wurden wir zum Haareschneiden geschickt. Ich ging nur unter Protest. Mein meist gehasster Satz war “Bitte einmal kürzen bis zum halben Ohrläppchen”.
Ach ja, und dann gab es noch die Drogerie Schmunck Haardtring Ecke Moltkestraße. Fast alle Mittel, die der Arzt in der Praxis oben drüber empfahl konnte man bei Schmunck kaufen. Es war ja ohnehin normal so viel wie möglich mit bewährten Hausmitteln zu behandeln. Und hat meist auch geklappt. Heute ist ein Hanfladen in den Räumen untergebracht.
Kaum zu glauben, aber auf dem Haardtring habe ich Fahrradfahren gelernt. Das schwere Herrenrad vom Vater – Vorkriegsmodell – war nicht einfach zu handhaben. Unter der Querstange durch haben wir uns in Schräglage vorwärts bewegt. Es gab heftige Streitereien wer wann damit fahren durfte, denn tagsüber war Vater damit zum Fernmelde Technischen Zentralamt (FTZ) unterwegs.
Gut erinnere ich mich auch an den Gasmann. In den ersten Jahren war die Siedlung mit Gaslaternen beleuchtet. In der Dämmerung kam ein Mann mit einer kurzen Leiter, lehnte sie an den Laternenpfahl und kletterte so weit rauf, dass er an der Öse, die unten aus der Laterne kam, ziehen konnte. Das Licht war erst fahl und fing erst etwas später an, zu leuchten. Für uns im Herbst und Winter das Zeichen, nach Hause zu gehen. Auch der Schornsteinfeger war interessant. Wir liefen schreiend hinter ihm her und riefen „Eins, zwei, drei, vier, das Glück gehört mir“. Und stritten dann, wer als erstes gerufen hatte.
Eine Besonderheit der Postsiedlung habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir wohnten zwar in Darmstadt, aber es gab so gut wie keine Darmstädter in der Siedlung. Fast alle Familien waren aus dem Norden oder Osten zugezogen. Das hatte zur Folge, dass wir ausnahmslos Hochdeutsch sprachen, höchstens mit kleinen Einfärbungen eines fremden Dialektes. Also ein kleines Ghetto.
Bei Schuleintritt konnte das zum Problem werden, denn die meisten anderen Kinder sprachen Heinerdeutsch. Wir Hochdeutschen waren nicht besonders beliebt. Zumal wir meist die Einsen im Diktat schrieben. Wir hatten es in diesem Punkt deutlich leichter, was uns aber verständlicherweise keine Sympathien einbrachte.
Mein erster Kontakt mit Dialekt war der Lumpensammler. Der kam alle paar Monate mit seiner Karre und einer Schelle durch die Siedlung. Selbst rufen musste er nicht, das haben wir ihm abgenommen: „Lumbe, Alteise, Babier, alles sammle mir unn gebbe nix defier“
Mara Anders
Die Postsiedlung – Solidarität findet Stadt.